|
101
Meisterwerke
Opus 88
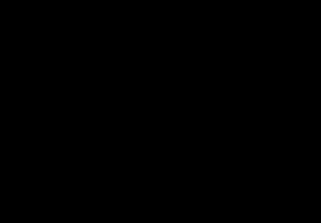
Schwarzgurtfinsternis
HAW, 2005, Museum
für Modernste Kunst
Über
das
Bild
Kein
Kunstobjekt der letzten Jahrhunderte hat mehr
unqualifizierte Kritik und Unverständnis hervorgerufen, als das hier
vorliegende Werk. Bei eingehender Betrachtung jedoch,
wird jegliche
Vulgärinterpretation durch die sachkundige Analyse des vorbereiteten
und zur Erweiterung seines Horizontes gewillten Beobachters der
Lächerlichkeit
preisgegeben.
Das
anfängliche Gefühl von Vertrautheit weicht schon nach wenigen
Stunden dem Erleben eines unbekannten Formenreichtums.
Überwältigt von der Kraft des Opus fühlt sich der Betrachter
verloren in der Vielzahl möglicher Interpretationen.
Dieses Werk ist nicht
einfach im Vorbeigehen zu konsumieren, vielmehr will es erforscht,
ja geradezu erobert
werden.
Die zunächst
scheinbar vorherrschende visuelle Homogenität erweist sich bei
näherer Inspektion als geschickte optische Täuschung, die sich
der Künstler bewusst als prägendes Stilmittel zur Formulierung
seiner
Intention reserviert.
Während
das Bild im Inneren von einer Vielzahl monochromatischer Kreisformen
und Rundungen geprägt wird, die konkrete Techniken diverser
Kampfstile darstellen und für die gebundene Form des Gürtels stehen,
sind seine Abgrenzungen zur Außenwelt von geraden und eckigen
Motiven beherrscht, gleichsam Techniken und Gürtel in ausgelegtem
Zustand verbildlichend. Und es ist dieser Kontrast, aus dem das Werk
seine zunehmende Dynamik
erzeugt.
Schon
bald explodiert die anfangs fälschlich angenommene Ruhe und wandelt
sich in ein Spektakel aus Kampfsequenzen, in eine Demonstration
höchster physischer und spiritueller Energiedichte, unerreicht und
die kühnste Vorstellung jeder Action Film Choreographie
sprengend.
Die
großzügige Abwesenheit stilistischer Elemente,
die dem ungeübten
Auge entgeht und doch in jedem Teil des Bildes präsent
ist, findet ihr
Pendant in der Selbsteinschätzung des Pseudo-Budoka. Nur
erahnen lässt sich die zugrundegehende Formenvielfalt als
Stellvertreter sämtlicher Kampfkünste, die das Bild mannigfaltig zu
unterstellen vermag. Damit distanziert sich das
Werk so erfrischend von der überdrüssigen Trivialkleckserei eines
Rembrandt oder Van
Gogh.
Gleichzeitig machen die
Proportionen der Komposition etliche, bislang als unumstößlich
geltende, Designprinzipien obsolet und bereiten so den Weg, weg von
aufdringlichen Form und Farbspielereien hin zur rein inhaltlichen
Dimension des Themas, ohne jedoch das Erscheinungsbild jemals
zu verschweigen oder auch nur zu
erwähnen.
Jedoch
ist es nicht gerechtfertigt, von der erweiterten Generalisierung
eines abstrakten Suprematismus zu sprechen. Fehlgeleitet durch
den Titel des Werkes, der „Schwarzgurtfinsternis“,
führt seine Interpretation als vollständiger oder teilweiser
Gürtel, in die Irre. Gleichermaßen ist der Hinweis auf die
Schwärze nicht relevant. Denn man könnte ebenso von
einer Weiß, einer Gelb oder einer beliebig anderen Gurtfinsternis
ausgehen.
Durch diese
Projektion sind sämtliche Gürtelstufen optisch nicht mehr
unterscheidbar und sowohl Anti-Meister als
auch Anti-Schüler entlarven sich durch die Wirkung der
aus ihrem jeweiligen Grad an Dilettantismus geborenen
Techniken.
Die spielerische Extravaganz der verworfenen
Initialinterpretation führt dem Betrachter die Überbewertung
des durch das Etikett, dem Gürtel, begründeten ersten Eindrucks vor
Augen und bietet gleichzeitig keinen Ausweg aus dem dadurch
enstehenden Meinungsvakuum.
So spielt das Werk mit Erwartungshaltungen, ohne diese
weder zu enttäuschen, noch ihnen zu entsprechen. Es
macht die eigenen Vorurteile
über auf Farbpaletten abgebildete Fähigkeit Hierarchien bewusst und
ermuntert dazu, diese kritisch zu
verdrängen.
Man
wartet geradezu darauf, dass jeden Moment die Finsternis der
Helligkeit weicht und aufgrund nicht erkennbarer Ursachen eine
wohldefinierte Buntheit freilegt, die sogenannte Graduierung,
mit dem Gürtel als deren
greifbare Materialisierung.
Ohne die von der Gürtelfarbe aufoktroierte
Interpretation lässt sich formal nicht mehr eindeutig
auf die Graduierung schließen, wodurch ein Feuerwerk
an facettenreichen Interpretationsmöglichkeiten entfesselt
wird. Alles Bunte sieht gleich aus in der schmeichelnden
Abwesenheit des mal täuschenden, mal offenlegenden Lichtes.
Der
Trugschluss des Rückschlusses von der Farbe auf das wirkliche Niveau
lässt sich in seiner ganzen Tragweite
erahnen.
Dieses
Phänomen wird auch nach vielmaligem Erleben nicht
abgeschwächt. Wir werden Zeuge einer inhärenten, sich permanent
selbst neu erfindenden Illusion, die ohne wirkliche Veränderungen
unablässig weitere Schattierungen gebirt, um schließlich
aus dem routinierten Nichts ein von sich selbst überzeugtes Schwarz
hervorzubringen. Der Kreis der farbgeschwängerten Inkompetenz
schließt sich und bietet ein Spiegelbild der Vorgänge in
Antivereinen und
Antiverbänden.
Kurzbiographie des
Künstlers
Bereits in seinem Frühoevre erstellte HAW
erste rudimentäre Konzepte seines späteren Meisterwerkes, die
immer wieder Verständnislosigkeit und Ablehnung
hervorriefen. Schließlich profilierte er sich im Bereich
der Rindswurst Radierung und
Zahnpastalitografie.
Nach dem Studium der bildenden Kunst mit einer
Abschlussarbeit über mäandernde Klärgrubenästhetik, machte sich der
Maler einen Namen mit bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der
theoretischen Paspartoutlackierung, die er als unabdingbare Vorstufe
zu seiner künstlerischen Selbstfindung
bezeichnet.
Im Jahr
2005 erhielt die „Komposition
mit Grün, Grün und Grün“
den Förderpreis der Gesellschaft für modernste Kunst und legte
damit den finanziellen Grundstein für das kommende Schaffen des
Maestros und einen Porsche.
Der internationale Erfolg zog vielmediale
Aufarbeitungen nach sich. So entstanden ein Bühnenstück, drei
Klingeltöne und mehrere Talk Shows. Schon früh sicherte sich
Hollywood die Rechte an dem Stoff. Galt das Werk lange Zeit als
unverfilmbar, wurde eine Realisierung
jetzt durch Fortschritte der Computeranimation
möglich.
Interpretationshinweise
Erfahrungsgemäß fällt es dem Neuling schwer, das Bild in
seiner Gesamtheit wahrzunehmen und zu würgiden. Oft ist es
daher hilfreich, zunächst einzelne Teile separat zu analysieren
und dann zusammenzufügen. Dadurch wird die
anfangs unendliche Menge möglicher Interpretationen mehr als
halbiert.
Für den akademisch gedüngten
Kunsthistoriker ergibt sich das
Werk als logische und
längst überfällige Folgerung aus Kaputten Videobildschirm
Installationen und den gefeierten
Frittenfettmobiles.
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht
jedoch immer die Bedeutung der Schwarzgurtfinsternis, als
Platzhalter für das Konzept der doppelten Negation, die Vertuschung
der Unfähigkeit des Anti-Budoka durch das eigentlich die
Meisterstufe verkörpernde Symbol der Schwärze, welche das
vorliegende Werk als einzigstes Artefakt in der Geschichte der
Menschheitskulturen zu illustrieren
vermag.
Schließlich ist dieses Bild, unabhängig von
seinem unschätzbaren intellektuellen Reichtum, ein Fest für die
Sinne, das die Eckpfeiler moderner Ästhetik neu definiert und die
Kunst in das nächste
Jahrtausend führt.
©
2007 SWV +
TDI |
![]()