![]()
111
Meisterwerke Opus 55-A Kollapsismus
I HAW 2011,
Museum für Moderne Kampfkunst
Einleitung „Die
Produktionskosten dieses Bildes belaufen sich auf 100 Millionen US
Dollar.“
Diese Aussage verblüffte die
Fachwelt bei der Pressekonferenz anlässlich der öffentlichen
Vorstellung des Werkes. Die Erklärung: Das vorliegende Objekt ist nicht
einfach ein Bild sondern ein zwei Stunden langer Kinofilm, bestehend
aus 172.800 Einzelbildern, die allesamt übereinander kopiert
wurden. Vorgeschichte: Form
+ Innovation Die Filmindustrie verzeichnet
rückläufige Zahlen. Nach der Einführung des Tonfilms, gefolgt vom
Farbfilm, gab es kaum wirkliche Neuerungen. 3D-Filme werden nur
zögerlich angenommen und die ersten 4D-Filme ernteten mit Ausnahme
einiger Rezensenten aus Parallelwelten nichts als Kopfschütteln.
Seit Jahrzehnten stagniert die Entwicklung des Geruchfilms, trotz
Milliarden Subventionen von der chemisch-pharmazeutischen Industrie
und bis 1990 von der
DDR. Auch die stilistischen Mittel
sind ausgereizt. Selbst ambitionierte Verfahren wie wackelnde
Bilder, hemmungslose Schwenks und abgehackte Zooms reichen den
modernen Filmschaffenden nicht mehr zur Realisierung ihrer
künstlerischen Utopien. Ein neues Element musste her und es wurde
von mutigen Visionären
gefunden. Ausgangspunkt war eine anamorphe
Ausschreibung der Filmförderung, die Konzepte hervorbrachte wie das
„Filmen
ohne Film“
als Weiterentwicklung minimal realistischer Aktionskunst, basierend
auf dem „Null-Zuschauer
Ansatz“
der Traumraum Schule, und die Ein-Pixel-Technologie der
kompositorischen
Ultrareduktionsfreunde.
Inhalt Der Film, das Bild, erzählt
die Geschichte der Kampfkunst, von den Anfängen bis heute. Die
neueren Aufnahmen werden dominiert von Anti Ereignissen, zeigen
Anti-Meister, Anti-Schüler, Anti-Verbände, Anti-Prüfer,
Anti-Graduierungen, Anti-Vereine und Anti-Training.
Da die Bilder in zeitlicher Reihenfolge ineinender kopiert
wurden, sind die aktuellen Vorgänge am klarsten zu erkennen. Der
Betrachter mag so beim ersten Ansehen zu dem Schluss kommen, dass
die heutige Situation das Maß der Dinge sei, gar ein Höhepunkt der
Evolution. Der Blick des Konsumenten wird getrübt vom Gift der
Oberflächlichkeit des leicht Erreichbaren. Erst bei genauerer
Begutachtung, erst beim Eintauchen in tiefere Bildebenen wird das
wahre Geschehen deutlich und der augenblickliche Zustand als eine
Collage des Grauens
entlarvt. Die Erkundung des Werkes
erscheint zunächst schwierig, ist aber mit etwas Einsatz von jedem
zu bewerkstelligen. Sogar die einfachsten
Rasterelektronenmikroskope, die man mit Physik Experimentierkästen
bauen kann, sind in der Lage, tiefere Regionen sichtbar zu machen.
Und die nächste Generation von Smartphones wird neben Trüffelschwein
Funktionalität auch Apps mit Teilchenbeschleunigeranbindung durch
Bluetooth aufweisen. So kann man sich auf Entdeckungstour begeben,
kann die Wirklichkeit hinter dem
Tagesgeschehen
erkunden,
kann reisen durch die Schichten und die Geschichte der Kampfkünste
und einer unbekannten Welt begegnen. Ganz nebenbei erleben wir hier
die Geburt einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, der sogenannten
Kampfkunst Forensik.
Internationale
Kritikerstimmen Der moderne Rattenfänger von
Hameln hat keine Flöte mehr, sondern eine Prüferlizenz, und er kommt
auch nicht mehr aus Hameln. Und die Fachverbände sind
Großhändler für Phantasie-Graduierungen geworden, ihre Vereine
Selbstbedienungsläden für die verstofflichten Insignien einer
kommerzialisierten Selbsttäuschungskultur. Es ist Augenwischerei im
industriellen Maßstab wie man es bislang nur von Investment Banking
und Bio-Atomkraftwerken
kannte. Das ist die Kernaussage
des Bildes.
... werden die schönen Künste um
eine Ausdrucksform bereichert, die selbst die ausgeklügelsten
Elefantenkuh Mobiles in den Schatten
stellt. ... erleben wir einen Jahrmarkt
der Unfähigkeit und Vetternwirtschaft, der sich durch dieses Werk
bis zu seinen Wurzeln zurückverfolgen
lässt. Obwohl der optische
Gesamteindruck von einem Einheitsbrei schmieriger
Grau-
und Schwarztöne geprägt wird, gibt es hier und da Reste
energiegeladener
Farbflächen. Der
Versuch, Konservendosen mithilfe von al dente gekochter Pasta zu
öffnen, wird in seiner bedenklichen Virtuosität noch vom Schönreden
der Anti-Dojos und Antisenseis übertroffen.
... wird
der Serienpfusch im Sport-Spaß Budo rücksichtslos entblößt.
... eines
der Dinge, die das Leben ändern können, ein Ausweg von der
Schnäppchenjagd nach wertlosen
Rangsymbolen. ... portraitiert mehrere Generationen von Budoka auf
ihrem idyllischen Weg in den
Abgrund. ... die enthusiastische
Gleichgültigkeit steckt an und macht Lust auf
mehr. ... illustriert eine Entwicklung, von der man sich immer
wieder gerne
abwendet. ...
versöhnt die Erkenntnis, dass es bald nicht mehr schlimmer kommen
kann. ...
gebirt die Romanze zwischen Heuchelei und Machtgeilheit ein
zauberhaftes Klima der Dekadenz.
... haben
sich die Helden der Vergangenheit als rückgratlose Mitläufer
entpuppt.
...
rituelle Lehrgänge als Gelddruckmaschine, eine
Hommage an vulgärkapitalistische
Abzocke. ... können jetzt die Früchte
jahrzehntelanger Konditionierung geerntet
werden. Resümee Dieses Artefakt ist das
Gründungswerk einer neuen Stilrichtung der bildenden Kunst, des
Kollapsismus oder Hyperkurzfilms. Belächelt, verachtet und
verspottet wie einst die ersten Vertreter des Impressionismus,
arbeitet auch hier die Zeit für das Genre und wird eine wahre und
andauernde Wertschätzung
hervorbringen. Die innewohnenden
Ausdrucksmöglichkeiten dieser Kunstform eignen sich in
revolutionärer Weise dazu, kulturhistorische Meilensteine in
kompakter Form darzustellen.
Eine nachhaltige Sichtweise auf
die Drei-Liter-Wassertomate, Online Akkupunktur und den
Volksentscheid über Klimawandel rückt in greifbare
Nähe. So ist dieses Exponat eine
Analogie zu Entwicklungen im Kampfkunstbereich. Es ermuntert den
Betrachter nicht nur Lehren zu ziehen, sondern auch neue Bilder zu
erzeugen, den Film und die Geschichte fortzuführen und das momentan
vorherrschende Geschehen zu einem dunklen Kapitel zu machen, zu
einer vermeidbaren
Bildstörung.
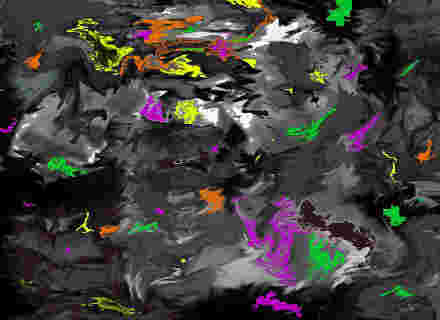
©
2011 HAW + TDI +
UFA