|
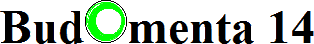
Wie ein Feld von
Obelisken wirkt der Platz vor dem Hauptgebäude. Aus der Nähe erkennt
man jedoch eine Installation aus Skulpturen in
Brötchenform.
Die entfesselte
Ornamentik dieses Ensembles zeigt, wie
die Wahrnehmung aus
der Entfernung täuschen kann. Es ist eine
starke Aussage über Dinge, die sich nur bei genauem
Hinsehen erschließen.
Und damit
willkommen zur wichtigsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst,
der Budomenta 14.
Während unseres Rundgangs stellen wir ausgewählte
Exponate vor und lassen Experten zu Wort
kommen.
Eine absolute
Neuerung ist die Philosophie des aktiven Konsums. Jedem Besucher
wird anstelle einer Eintrittskarte ein weißer Hula-Hoop-Reifen
überreicht.
Hinter dem Eingang begrüßt uns ein
scheunentor-großer Hund aus glänzendem Metall mit Halsband und
löchriger Leine, die schlaff zum Boden
hängt.
Dies ist ein Isotop der Kollateralkunst, dessen Unaufgeregtheit sich jeder
Analyse entzieht. Die monolithische Ästhetik spricht für sich
selbst.
Etwas weiter sind Bilder und
Skulpturen großer Meister aufgestellt. Dazwischen befindet sich eine
Güllegrube, über der ein Geier aus Plastik kreist. Das Ganze ist
umrahmt von hochwertigem Tropenholz. Daneben stehen
Kommunikationsbeauftragte, die dem geneigten Zuschauer
Argumente für die Wichtigkeit und Schönheit der Darbietung liefern.
Diese Inszenierung entfacht kinetischen Brechreiz. „Schaulaufen der Ignoranz und
kollektive Bestrafung aller Sinne”, sagen die einen; für andere
eröffnet sich eine Möglichkeit, den Kunstmarkt
nach ihren Visionen zu prägen. Auf jeden Fall ist es ein Vorbote für
künftige
Entwicklungen.
Da muss ich widersprechen.
Welch mutiger und wunderbarer Ansatz ! Man kann über die Bedeutung
des Werkes geteilter Meinung sein, aber nicht darauf einzugehen
zeugt von einem tertiären Demokratieverständnis. Solch eine
Präsentation kann den Zauber ungehemmter Globalisierung einer
breiten Masse
nahebringen.
Vorbei an
Pantomimen, die mit imaginären Farbbeuteln werfen, gelangt man zu
einer der wenigen
Dichterlesungen. Der Vortragende hockt auf einer Mülltonne und
rezitiert stundenlang den immer gleichen Satz, der da lautet: „Der Weg
war mein Ziel und getäuscht wurd ich viel.”
Es ist eine majestätische Arbeit, die in der
Fachliteratur als erster akustischer Raumteiler gefeiert
wird.
Einer der Publikumsmagnete ist der Pavillon, über
dem ein Neon Schild mit der Aufschrift „Wartezeit” thront. Hier baumeln bunt gefärbte
Bananen, nach denen man sich strecken kann, die aber nach einiger
Zeit auch von selbst runterfallen. So legen sich die meisten
Besucher einfach darunter
und warten.
Das gibt uns zu denken und dann wiederum
nicht.
Neuen Technologien widmet sich der angrenzende
Acker.
Dort ist eine überdimensionale Tastatur ebenerdig
eingebaut und mit Satzteilen beschriftet. Mehrmals am Tag lässt man
darauf Kühe, Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner und anderes
herumlaufen. Nach einer Grammatikprüfung durch einen Computer mit
zehn Gramm Künstlicher Intelligenz werden die erzeugten Sätze in
sozialen
Netzwerken veröffentlicht.
Wie, wenn überhaupt, und warum ist das einzuordnen
?
Eindeutig als Zukunft der Kommunikation. Eine
Orgie von beliebig angeordneten
Symbolen.
Schwein Nummer 45 hat bereits Millionen Follower
und ist aktiv in Diskussionen über
Wirtschaftspolitik eingebunden. Ist das zu
verantworten
?
Jegliche objektive Diskriminierung basiert auf
einer oder mehreren asymmetrischen Meinungsfreiheiten. Fakt ist,
dass die Perfomance spielerisch die Kluft zwischen Unfähigkeit und
schlechtem Geschmack
überbrückt.
Nun zu einem Pavillon, vor dem ein riesiger, mit
dunklem Stoff ausgekleideter Trichter magische Anziehungskraft
ausübt.
Der Innenraum ist auf ganzer Länge mit einem schmalen
Steg durchzogen, der die Fläche in zwei Abschnitte
teilt.
Auf der einen Seite bewerfen sich die Darsteller mit
Wattebäuschen und jonglieren mit Daunenfedern. An der Wand hängen
Selbstportraits von Zierpflanzen. Bei Tofu mit Jutedressing wird über Raufasertapeten
meditiert. Dann geht es ab zum Seifenblasen-Ego-Shooter.
Auf der anderen Seite üben die Akteure mit Jo-Jos aus
Hanteln und Stahlketten, spielen Völkerball mit Bowlingkugeln und
trampeln aufeinander rum. Nach dem Amboss-Beißen brüllen sie sich in
Spiegeln selbst an. Eine Kissenschlacht mit gefrorenen Rinderhälften rundet
die Nummer ab.
Wir balancieren auf dem immer enger werdenden Pfad
und müssen aufpassen, nicht abzurutschen.
Diese Demonstration ist ein extrovertiertes Statement über den real
existierenden Kunstbetrieb.
Wer das abstreitet, der leugnet auch den anderen
Klimawandel.
Wieder draußen, wartet
eine Plattform mit
einer den olympischen Ringen nachempfundenen Konstruktion. Sie ist
perfekt ausgeleuchtet, und die rundum aufgebauten Kameras übertragen
die Show in die ganze
Welt.
Professionelle
Athleten
hüpfen hektisch auf
der Stelle oder vor und zurück und machen kopfüber Hampelmänner,
während die an ihnen angebrachten Wunderkerzen funkelnd
abbrennen.
Einige tanzen
betört um eine Anordnung von Pokalen und
Medaillen.
Andere sind nach
ganz oben geklettert und rotieren mit kraftvollen Bewegungen
gusseiserne
Hula-Hoop-Reifen.
Gleichzeitig läuft
die Uraufführung eines dreidimensionalen Schachspiels mit
Straßenpollern.
Die Hip-Hop Version
der Nationalhymne sorgt hierbei für musikalische
Untermalung.
Zum Finale ergießt
sich über der Bühne ein Konfettiregen, der in eine Flut von
Geldscheinen übergeht, die bald alle Konturen bis zur
Unkenntlichkeit verwischen.
Früher wurde so etwas nicht für möglich gehalten,
doch jetzt werden ganz neue Konsumenten angesprochen, die davon
nicht genug bekommen
können.
Der offizielle Ausstellungskatalog preist das
Spektakel als moderne Sportkunst. Fachleute werten es jedoch als
vorauseilendes Mahnmal für die Dualität zwischen Ausbeutung und
Dekadenz.
Hier wird eine kreative
Nische ausgenutzt, die den Betrachter zum Mittäter macht.
Auf jeden Fall ist es ein Sittengemälde voll
verschwendeter Potentiale, beliebig interpretierbar und doch
eindeutig in der
Aussage.
Das
erinnert an die Parallelausstellung zur Budomenta 14, die
thematisiert, wie Kultur durch die Symbiose von Kapitalismus und
Dilettantismus kaputt kuratiert wird.
Wir blicken noch einmal auf die Frontwiese, wo
immer mehr Personen ihre Köpfe in die Brötchenskulpturen
stecken.
Beim Verlassen des
Geländes wird jedem Besucher ein neuer Hula-Hoop-Reifen überreicht,
diesmal in edlem
Schwarz.
Was bleibt, sind
starke Bilder über den Status Quo und ein Nachdenken über die Budomenta der Zukunft. Solche Programme haben
das Potenzial zu Großem, können aber auch im Sumpf
institutionalisierter Fehler steckenbleiben. Dann werden die
Hebammen des Konzeptes zu deren Zerstörern.
Aber da sind ja noch andere, durchaus auch
kleinere Veranstaltungen, die sich zu besuchen
lohnt.
Damit verabschieden
wir uns bis zum nächsten Mal und hula-hoopen in den Sonnenuntergang,
auf der Suche nach Kunst, wo noch niemand zuvor Kunst gesucht hat.
© 2017 DEA + GNM + HAW +
TDI +
UNE | 
